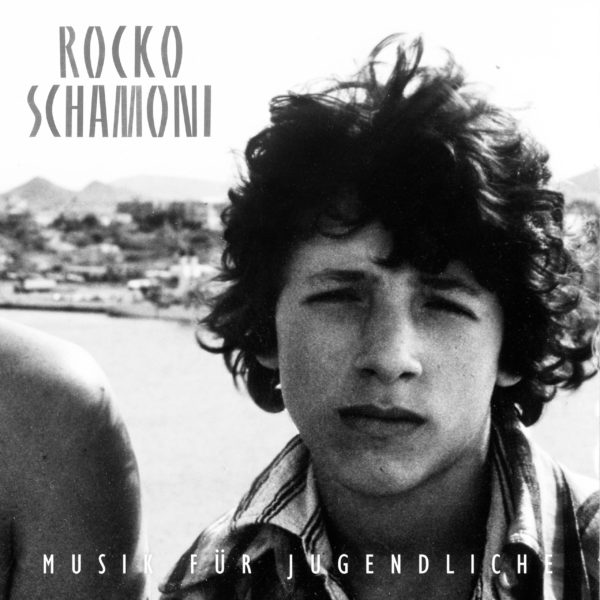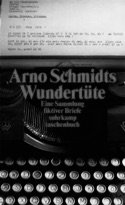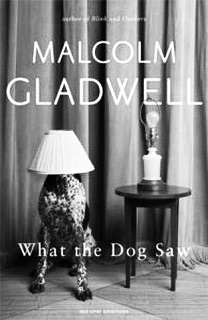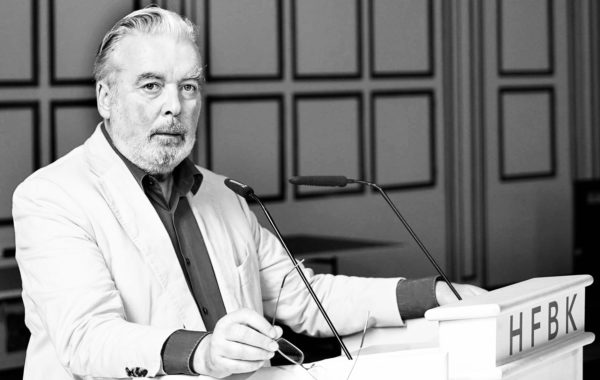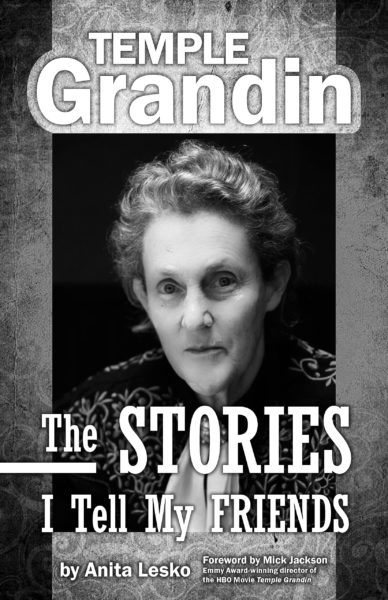Alles ruft nach Utopien. Endlich. Aber was genau ist das noch mal? Hier spricht der Erfinder der Utopie, der Staatsmann Thomas Morus aka Sir Thomas More, über die ideale Gesellschaft.
Herr Morus, Sie haben Utopia als Begriff erfunden. Was bedeutet er? Das ist ein Wortspiel mit den griechischen Bezeichnungen „Outopia“ (Οὐτοπεία) = Nicht-Ort und „Eutopia“ (Εὐτοπεία) = „glücklicher Ort“. Ich spiele gern.
Wie kamen Sie dazu, aus dem Begriff ein ganzes Werk zu machen? Mich beunruhigten die Verhältnisse, in denen wir leben. Deshalb hat „Utopia“ auch zwei Teile. In Teil 1 übe ich die nötige sachliche Kritik an den herrschenden Verhältnisse in meinem England. An sozialen Missständen, Konflikten, Kriegen, Kriminalität. In Teil 2 entwerfe ich ein fantastisches Gegenmodell als Idealzustand. Eine echte soziale Utopie. Ich lasse einen Weltreisenden seinen Freunden von einer fernen, glücklichen Insel erzählen. Das Ganze ist also teils Reisebericht und Inselmärchen, teils politische Mahnschrift. Es geht darum, was eine wirklich gute Gesellschaft ausmacht.
Worum genau geht in „Utopia“? Die Rahmenhandlung geht so: Ein Seemann behauptet eine Zeit lang bei den Utopiern gelebt zu haben. Er berichtet davon, wie die Gesellschaft da funktioniert und worauf sie basiert: auf Gleichheit, guter Arbeit, dem Streben nach Bildung. Ganz wichtig: Es gibt keinen Besitz bzw. aller Besitz ist gemeinschaftlich. „Utopia“ ist, so berichtet der Seemann euphorisch, so etwas wie ein Wachtraum von einer Insel. Reiches, entlastetes, freizügiges Leben für alle. Kein Zwang, nirgends. Menschenfreundliches Zusammenleben ohne Verbrechen und Konflikte. Kultur von Kindesbeinen an. Das Gegenteil von dem, was sich real in weiten Teilen der Welt abspielt.
Wie kann so ein Gesellschaftsmodell allen Ernstes möglich sein? Die Insel Utopia ist vor allem deshalb eine so menschenwürdige, weil ihre Bewohner weitestgehend von der Fron der Arbeit befreit sind. Sechs Stunden mäßiger Mühe reichen aus, um alle notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen und auch genügend Vorrat für Annehmlichkeiten herzustellen. Die goldene Grundregel lautet: Mäßige Arbeit, nicht über sechs Stunden, und der Ertrag wird gleichmäßig verteilt. Dann beginnt das Leben jenseits der Arbeit, ein Leben der glücklichen Einheit der Familie im schön bereiteten Mehrfamilienhaus. Und damit nicht mal der Schein von Privateigentum aufkommt, gilt: Alle 10 Jahre werden die Häuser nach Losverfahren gewechselt. Im Zentrum der Insel, auf dem Forum befinden sich Speisehäuser (alles lecker und alles umsonst natürlich), Lehranstalten und Tempel. Hier dürfen übrigens alle möglichen Götter gepriesen und angebetet werden; oder gar keine. Utopia ist das Eldorado der Freiheit, auch der Glaubensfreiheit. Die Wirtschaftsverfassung Utopias hat vor allem ein Ziel: allen Bürgern möglichst viel Zeit für die Pflege geistiger Bedürfnisse frei zu machen.
Der Modus Vivendi ist das freie, friedliche Mit- und Nebeneinander… Genau. Animiert von einem Gemeingeist, der weder Privateigentum kennt noch individualistische Launen duldet. Eine Gesellschaft ohne Geld und Eigentum. Denn Eigentum schafft Herren und Knechte, schafft Konflikte unter den Herren, Bedürfnisse nach Macht und Obrigkeit, Kriege um Macht und Obrigkeit, alle Übel also.
Brüder und Schwestern koexistieren frei und friedlich in einer Inselkommune. Etwas „weltfremd“, oder? Wollen Sie mir damit sagen: Meine Utopie ist unrealistisch? Dann sage ich Ihnen: Ich denke und erzähle im Auftrag des Kommenden. Eine Utopie ist immer eine Noch-Nicht-Realität.
Wenn Sie das gesellschaftlich Gute an „Utopia“ in aller Kürze zusammenfassen müssten… Ein Minimum an Arbeit und Staat. Ein Maximum an Freude.
Haben Sie eine Lieblingspassage? Ja, den Schluss des zweiten Teils. Ich darf mich mal selbst zitieren: „Welche Last von Verdrießlichkeiten ist in diesem Staat abgeschüttelt, welche gewaltige Saat von Verbrechen mit der Wurzel ausgerottet, seit dort mit dem Gebrauch des Geldes zugleich die Geldgier beseitigt ist. Denn wer sieht nicht, dass Betrug, Diebstahl, Raub, Streit, Aufruhr, Zank, Mord, Verrat mit der Beseitigung des Geldes alle zusammen absterben müssten und dass überdies auch Furcht, Kummer, Sorgen, Plagen und Nachtwachen in demselben Augenblick wie das Geld verschwinden müssten?“
Was halten Sie davon, wenn man Ihr Werk „das goldene Büchlein von der besten Staatsverfassung“ nennt? Find ich gut und zutreffend.
Das Interview mit Thomas Morus ist fiktiv, die Antworten sind collagiert aus diesen Quellen: Ernst Bloch: Freiheit und Ordnung. Abriss der Sozialutopien; Kindlers Neues Literaturlexikon; Thomas Morus: Utopia. Mit einem Nachwort von Peter Sloterdijk; und wikipedia.de.