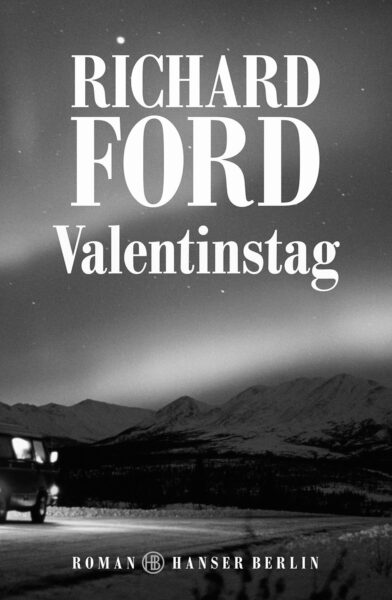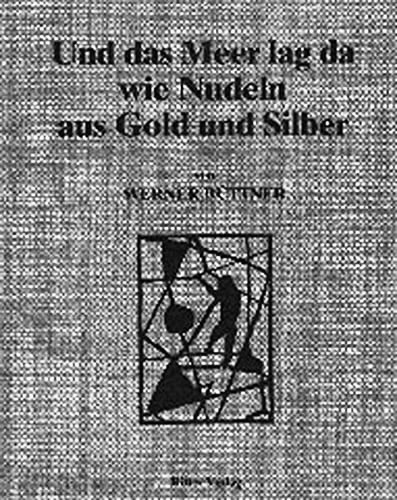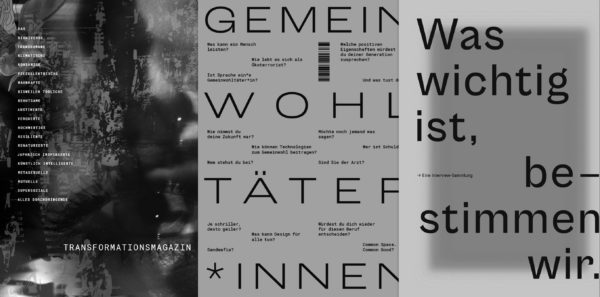Im Juli 2005 wird Anthony Walker bei einem rassistischen Angriff in einem Park in Liverpool ermordet. Er ist gerade 18. Inspiriert durch Gespräche mit Gee Walker, Anthonys Mutter, über den Jungen, der Anthony war, und den Mann, der er werden sollte, erzählt das BBC-Drama Anthony“ die Geschichte des Lebens, das er hätte leben können. Der Story-Clou dabei: Anthonys imaginiertes Leben wird in umgekehrter Chronologie erzählt. Wir treffen ihn, als er 25 ist, und arbeiten uns von dort rückwärts vor. Wir sehen, wie er seine Träume verwirklicht und das Leben genießt, bis zum Augenblick, als die Fiktion endet und die biografische Wahrheit uns voll trifft: Zwei von Hass besoffene Männer verfolgen ihn von einer Bushaltestelle aus in einen Park und erschlagen ihn dort mit einem Eispickel.
Jimmy McGovern, Autor von „Anthony“, erzählt, wie er auf die Idee kam:
„I’d been thinking about the First World War, about how the powers-that-be kept everybody fighting right up to the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month. Even though everyone knew the war was over they kept on fighting and between dawn and eleven o’clock on the eleventh day, thousands died. I would argue that every single death in the First World War was pointless but those that occurred on that final day were the most pointless of all.
I kept asking myself, “How many of those men who died that day would have achieved great things had they lived? Discovered a cure for a virus perhaps, written a great book, painted a beautiful picture?” That got me thinking about Anthony’s hopes and dreams. Had he lived, would he have achieved them? That question lies at the very heart of this drama.“
Mehr hier.